News21. Februar 2020
 Irina Blum
Irina Blum
Berlinale 2020: «The Roads not Taken» mit Javier Bardem und Elle Fanning verliert sich in Belanglosigkeit

Berlin ist vom 20. Februar bis zum 1. März im Filmfieber: Zum 70. Mal geht diese Tage in der deutschen Hauptstadt die Berlinale über die Bühne. Bei uns gibt es laufend Kritiken zu den Filmen im Wettbewerb sowie ausser Konkurrenz.
The Roads not Taken | Wettbewerb

Ein Filmfestival lebt nicht nur von guten und spannenden Filmen, es braucht auch immer etwas Glanz und Rummel um Stars und Sternchen, um die richtige Festivalstimmung auf den roten Teppich zu zaubern. Dank des Wettbewerbsbeitrags «The Roads not taken» der englischen Regisseurin Sally Potter brachten Javier Bardem, Salma Hayek und Elle Fanning bei der 70. Berlinale Hollywood-Glamour nach Berlin.
«The Roads not taken» ist trotz Hollywood-Besetzung jedoch kein Mainstreamfilm – im Gegenteil, denn das mehrschichtig erzählte Drama über die Beziehung eines dementen Vaters und seiner Tochter kommt ziemlich verschlossen daher. Regisseurin Sally Potter springt von Beginn an zwischen den Erzählebenen hin und her – ob Leos Gedanken Erinnerungen oder Träume sind, bleibt erstmal unklar. Es ist der Versuch, ein komplexes Bild des Protagonisten zu zeichnen, das weitaus grösser ist, als das eines geistig verwirrten Mannes, der vom Alltag überfordert ist.
Charlatan | Berlinale Special

Kritik von Walter Rohrbach
«Charlatan» basiert auf wahren Ereignissen und erzählt die Geschichte des wissbegierigen tschechischen Heilers Jan Mikolášek, der in der Tschechoslowakei vor dem Zweiten Weltkrieg zu einer Art Institution wurde, unter den Kommunisten aber zunehmend unter Druck kam. Es ist eine dunkle, klaustrophobische Welt, in die uns die Regisseurin Agnieska Holland mitnimmt: Ihr 188-minütiges Biopic ist ein vielschichtiges und düsteres Werk geworden, das – obwohl durchaus gut gemacht – auch etwas überladen und gar düster geraten ist.
Berlin: Alexanderplatz | Wettbewerb

Kritik von Cornelis Hähnel
Mit Spannung wurde der zweite deutsche Wettbewerbsbeitrag der Berlinale erwartet – schliesslich wagt sich Regisseur Burhan Qurbani mit seiner Neuverfilmung von «Berlin Alexanderplatz» an einen Meilenstein der literarischen Moderne. Und – wie ihm Film sei hier das Ende auch direkt vorweggenommen – das gelingt ihm streckenweise sehr gut.
Regisseur Burhan Qurbani transportiert mit seiner Neuverfilmung Alfred Döblins Roman in die Gegenwart. Mit aufwändig komponierten Bildern nutzt er die visuelle Kraft des Kinos, sein Berlin ist ebenso dunkel wie künstlich, und im Schein des Neonlichtes sind die Abgründe der Gesetzeslosigkeit fast unsichtbar. Hauptdarsteller Welket Bungué spielt Francis mit unerschütterlichem Glaube an das Gute im Menschen, auch wenn man von Anfang an weiss, dass sein Absturz bereits beschlossene Sache ist.
Schwesterlein | Wettbewerb

Kritik von Cornelis Hähnel
Die Berlinale ist so etwas wie ein grosses Familientreffen: Einmal im Jahr kommt man aus der ganzen Welt zusammen, freut sich über ein Wiedersehen mit vertrauten Gesichtern, ist gesellig, trinkt zu viel, und der komische Onkel mit seinen ewig gleichen Geschichten ist auch wieder da. Ja, die Filmwelt ist eine grosse Familie. Und um Familie und Wahlverwandtschaft geht es auch im Schweizer Wettbewerbsbeitrag «Schwesterlein».
«Schwesterlein» ist ein klassischer Schauspieler-Film, in dem vor allem Nina Hoss und Lars Eidinger als inniges Geschwister-Paar brillieren. Das Regie-Duo Stéphanie Chuat und Véronique Reymond verknüpft dabei Realität und Fiktion, bleibt aber trotzdem eng an ihren Figuren. Statt komplexer Handlungsstränge konzentriert sich der Film auf die emotionale Ebene der Figuren und zelebriert unaufgeregt und mit viel Spielwut die Kraft der Kunst und die Kultur als Lebenselixier.
Undine | Wettbewerb

Kritik von Cornelis Hähnel
Mit «Undine» hat sich Christian Petzold den Mythos über den gleichnamigen Wassergeist vorgenommen und seine Trilogie über die deutsche Romantik begonnen. Er verlagert den Stoff in die Gegenwart und lässt seine Protagonistin gegen ihr vorgeschriebenes Schicksal kämpfen. Dabei ist das elementare Wesen der deutschen Romantik, die Melancholie, stets präsent, über all der Liebe liegt stets ein morbider Schleier des Verfalls. Leicht der Realität entrückt und mit flirrender Poesie erzählt fügt sich der Film so nahtlos in Petzolds Oeuvre ein.
Never Rarely Sometimes Always | Wettbewerb

Kritik von Walter Rohrbach
Die Regisseurin Eliza Hittman legt mit «Never Rarely Sometimes Always» ein Drama vor, das auf ganzer Linie überzeugt. Mit feinen Zügen porträtiert sie unaufgeregt und mit realistischen Bildern das Schicksal von Autumn, ohne ihre Misere sensationell zu machen oder den Film allzu stark in Richtung Melodrama kippen zu lassen. Eindrücklich zeigt sie die konkreten Auswirkungen von gesellschaftlichen Regeln auf, welche die Selbstbestimmung beschneiden. Damit ist dieser Film überaus gelungen und wird im feministischen Kino berechtigterweise seine Spuren hinterlassen.
Pinocchio | Berlinale Special

Kritik von Cornelis Hähnel
Der italienische Regisseur Matteo Garrone erzählt die Geschichte von Pinocchio als werkgetreuen Klassiker. Dafür lässt er das Italien Ende des 19. Jahrhunderts wieder auferstehen, Braun- und Erdtöne dominieren die Szenerie, zwischen Stroh und grobem Leinen setzt Pinocchio mit seinem roten Kostüm stets einen kräftigen Farbtupfer. Ein tolles Maskenbild und viel Liebe zum Detail machen «Pinocchio» zum klassischen Familienfilm.
Time to Hunt | Berlinale Special

Kurzkritik von Irina Blum
Jun-seok (Je-Hoon Lee) hat gerade drei Jahre in einem südkoranischen Gefängnis hinter sich. Um an das grosse Geld zu kommen und seinen Traum zu erfüllen, nach Taiwan auszuwandern – schliesslich sehen die Strände dort ähnlich aus wie ihn Hawaii – plant er jedoch schon seinen nächsten Coup.
Gemeinsam mit seinen Kumpels will er ein illegales Casino ausrauben. Vor allem Ki-Hoon (Woo-sik Choi, der Junge aus «Parasite») ist skeptisch, lässt sich mit der Aussicht auf ein Vermögen, mit dem er für seine in ärmlichen Verhältnissen lebenden Eltern sorgen könnte, schliesslich aber überzeugen. Das äusserst riskante Unterfangen gelingt den vier jungen Männern dann auch – doch nebst dem Geld klauen sie unwissentlich auch Tapes mit sensiblen Informationen, weshalb ein Auftragskiller schon bald die titelgebende Jagd auf Jun-seok und Co. macht.
Angelegt ist der Thriller von Sung-hyun Yoon in einem dystopischen Südkorea nach einer Finanzkrise: Die hiesige Währung ist praktisch wertlos, Dollars fast nicht mehr zu bekommen, ganze Quartiere in Städten verlassen und Kriminalität allgegenwärtig. Etwas gar plakativ wird dies zu Beginn vor Augen geführt; gewisse Szenen erinnern bezüglich ihrer Machart gar an amerikanische Rap-Videos aus dem Ghetto.
Insbesondere nach dem Überfall auf das illegale Spielkasino in einem verlassenen Industriegebiet nimmt der Thriller dann an Fahrt auf, was vor allem den vielen absolut ohrenbetäubenden Schüssen geschuldet ist, die während den rund zwei Stunden abgegeben werden: Unterstrichen von einem eindringlichen Score sind es vor allem diese, die einem immer mal wieder aus dem Kinosessel aufschrecken lassen.
Mit dem Hintergrundwissen, dass Südkorea anders als die USA eine sehr restriktive Waffenpolitik verfolgt, wird relativ schnell klar, dass «Time to Hunt» anders als «Parasite» nicht politisch aufgeladen ist, sondern dem reinen Action-Vergnügen dienen soll.
Dieses jedoch wird durch einige Durchhänger gestört – die Laufzeit von über 2 Stunden ist für einen reinen Rachethriller wie diesen dann doch etwas zu ambitioniert angelegt. Hinzu kommt, dass die jungen Männer zwar sympathische Figuren abgeben und die beinahe Brüder-artige Dynamik in der Gruppe authentisch verkörpern, schliesslich aber doch etwas zu naiv daherkommen, um die actionreiche Story einer verzweifelten Flucht glaubhaft zu machen. Nicht abstreiten lässt sich hingegen, dass selten ein Film so viel Respekt vor Waffen aller Art einflösst: Die dröhnenden Schüsse hallen ohne Frage nach – und sind nichts für Zartbesaitete.
2.5 von 5 ★
My Salinger Year | Eröffnungsfilm ausser Konkurrenz

Kurzkritik von Irina Blum
Amerika, 1995. Die junge Literaturstudentin Joanna (Margaret Qualley) hat einen grossen Traum: Sie möchte Schriftstellerin werden. Dafür gibt sie ihr Leben an der Westküste mit ihrem College-Freund auf und kehrt zurück in ihre Heimatstadt New York, wo sie im Mini-Apartment ihrer besten Freundin zunächst deren Gastfreundschaft überstrapaziert und später mit einer neuen Bekanntschaft (Douglas Booth) zusammenzieht.
Die absurd hohe Miete finanziert sie mit der kürzlich an Land gezogenen Stelle als Assistentin der Literaturagentin, die den berühmten Schriftsteller J. D. Salinger vertritt. In Tat und Wahrheit ist das Team rund um ihre Chefin Margaret (Sigourney Weaver) aber nicht damit beschäftigt, dem 70-Jährigen neue Arbeit zu beschaffen, sondern die Aussenwelt vom Schriftsteller fernzuhalten, der schon seit Jahren nichts mehr publiziert hat.
Joanna wird dann auch gleich zu Beginn mitgeteilt, dass "Schriftstellerinnen die schlechtesten Assistentinnen" seien und sie die Finger vom Schreiben lassen soll. Stattdessen muss sie sich um die zahlreiche Fanpost von Salinger kümmern, die in der Regel mit einer Standardformulierung beantwortet und direkt geschreddert wird. Eine unbefriedigende Situation für Joanna, die die Sache schliesslich selbst in die Hand nimmt.
Das Coming-of-Age-Drama «My Salinger Year» basiert auf dem gleichnamigen, autobiografisch geprägten Roman von Joanna Rakoff und wurde von Philippe Falardeau (Regie und Drehbuch) für die Leinwand umgesetzt. Mit schön eingefangenen und inszenierten Retro-Bildern eines New York aus der Vergangenheit – Computer kamen gerade auf, Smartphones waren Zukunftsmusik – beschwört Falardeau nostalgische Gefühle rund um eine junge Frau herauf, die ihren Ambitionen zu folgen versucht.
Zwar über gewisse Strecken etwas langatmig geraten, funktioniert «My Salinger Year» vor allem dank der guten Chemie zwischen der soliden Sigourney Weaver und der sympathischen Newcomerin Margaret Qualley («Once Upon a Time in Hollywood»), die beide ihren Figuren Ecken und Kanten verpassen. «My Salinger Year» ist eine Liebeserklärung an die Kraft von Büchern und Kunst – ein schönes Zeichen zudem, dass das erste Festival unter der Leitung von Carlo Chatrian mit zwei solch starken Frauen(-figuren) startet.
3.5 von 5 ★
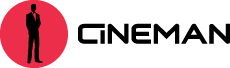












Sie müssen sich zuerst einloggen um Kommentare zu verfassen.
Login & Registrierung