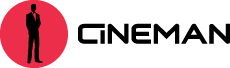Interview
«Eine Fleisch gewordene Musiknote»

Tate Taylor – sein Rassendrama «The Help» war mehrfach Oscar-nominiert – auf der Suche nach der Seele des «Godfather of Soul»: der Regisseur über Angst, Kunstschnee und «Ich muss mal»-Songs.

Beginnen wir mit Ihrer Plattensammlung, Herr Taylor.
In Mississippi, wo ich herkomme, spielen wir fast nur James Brown. Oder Elvis Presley. (lacht) Was lustig ist: Als meine Mutter mich auf dem Set besuchte, brachte sie mir sechs der James-Brown-Alben mit, die sie sich als junge Frau im College gekauft hatte. Auf ein Cover hatte sie gekritzelt: «Ausleihen darfst du sie dir. Aber ich will sie zurückhaben!» Das zeigt, was James Brown den Leuten bedeutet: Da ist meine Mutter, eine Weisse, die im schwarzen Mississippi auf eine christliche Mädchenschule geht. Aber James Brown – das war die Musik, die alle sich anhören wollten.
James Brown sass für bewaffneten Raubüberfall im Knast, er sang für die US-Truppen in Vietnam und wurde zur Identifikationsfigur der schwarzen Bürgerrechtsbewegung, der zuhause auch mal die Ehefrau verprügelte. Haben Sie Seiten an James Brown entdeckt, die Sie im Film aussparen wollten?
Ich selbst mag Biopics nicht so, die sind mir meist zu simpel gestrickt. Und warum soll ich ins Kino gehen, wenn ich etwas über jemanden erfahren will? Das kann ich einfacher haben. Für Get on Up habe ich erst mal alles vergessen, was ich von James Brown kannte. Die Musik. Den Ruhm. Ich wollte ein Psychogramm zeichnen – von ihm und den Männern seiner Art. Was sind ihre Dämonen? Ihre Ängste? Was treibt sie an?
Verraten Sie es uns: Was trieb den «Godfather of Soul» an?
Im Grunde war er sein Leben lang ein verängstigter kleiner Junge. Er hat als Siebenjähriger sechs Wochen allein im Wald gelebt, nachdem seine Mutter ihn verlassen hatte – unvorstellbar. James Brown war getrieben von seinem Perfektionismus und noch im Erfolg gepeinigt von einer panischen Angst, das alte Leben würde ihn wieder einholen. Und in diesen Wunsch, es möge nie wieder so schlimm sein, wie es war, schlich sich die Frage: Wie berühmt kann ich werden?
Was Get on Up von anderen Biopics unterscheidet, sind die wilden Sprünge auf der Zeitachse. Eben noch im Bordell der Ersatzmutter, schon live im Pariser Olympia! Was erhofften Sie sich von dieser non-linearen Erzählweise? Sie werden sich ja nicht nur wegen des funky Rhythmus dafür entschieden haben.
Da wären wir wieder bei dem Psychogramm, von dem ich vorher sprach. Wenn man einen Menschen erst in seine Bestandteile zerlegt, weil man wissen will, wer er war, dann erzählt man sein Leben anschliessend nicht chronologisch nach und suggeriert so Zusammenhänge, sondern man bildet ein Mosaik aus den verschiedenen Momenten, die dieses Leben ausmachten. Ein schöner Nebeneffekt ist: Das kennt man von Biopics nicht so. Ich glaube ausserdem, dass dieser Ansatz James Brown sehr nahe kommt: Er wollte, dass niemand auch nur den Hauch einer Ahnung davon hatte, was als nächstes passiert.
Was man aber ziemlich sicher weiss: Gleich kommt der nächste James-Brown-Hit.
Ich wollte, dass man sich seine Lieblingssongs in aller Ruhe anhören kann. Man kann ja pinkeln gehen oder sich Popcorn holen, wenn man einen Song mal nicht mag? Wichtig war mir, dass jeder Song im Film eine Bedeutung hat und die Geschichte vorantreibt.
Wie stark haben sich die Browns in Ihren Film eingemischt? James Browns Familie ist gross, um sein Erbe wurde erbittert gestritten. Es wird ihr trotzdem daran gelegen gewesen sein, ihren James ins beste Licht gerückt zu sehen?
Chadwick Boseman (der Hauptdarsteller, Anm. der Redaktion) und ich sind nach Atlanta geflogen und haben einen Wagen gemietet, wir nannten es die «James-Brown-Tour». Wir haben Leute getroffen, die ihn kannten – Freunde, Bandmitglieder, seine zweite Frau Deedee. Ich sagte ihr, dass ich im Film auch die häusliche Gewalt zeigen würde, was sie natürlich nervös machte. Ich habe ihr einen Deal angeboten: Ich schreibe die Szene, schicke sie dir und wir besprechen sie. Mein Bemühen war es, die ganze Familie mit einzubeziehen. Und die wird ja immer noch grösser! (lacht)
Wie oft wollte Mick Jagger das letzte Wort haben, der Get on Up mitproduziert hat und einen Grossteil der Rechte an James Browns Musik besitzt?
Die Meetings, das Betteln um Geld: auch Mick Jagger blieb nichts erspart. (lacht) Auf dem Set war er aber nur vier Tage. Sein wichtigster Beitrag zum Film war die Zeit, die er mit Chadwick verbrachte. Mick hat ihm das Ego erklärt, das ein Frontman braucht. Dass er nicht nur die Band dirigiert, sondern auch das Publikum. Mick und Chadwick haben sich bei einem Tee gemeinsam das berühmte «Live at the Appollo»-Album angehört. (lacht) Bei einer Tasse Tee! Ich habe das nie kapiert: Wenn es wenigstens Bier gewesen wäre?
Die bizarrste Szene im Film: Wie James Brown im Kunstschneetreiben und schneeweissen Strickpullover «I Feel Good» singt. Was er ja tatsächlich so getan hat – in Frankie Avalons Film Ski Party.
Das ist einer dieser Klischee-James-Brown-Songs, die zwingend in den Film gehörten; «I Feel Good» wird in den USA auf jeder Hochzeit gespielt. Ich habe mir also gut überlegt, wie ich den einbaue und ihn glücklicherweise in der Komödie von Frankie Avalon entdeckt. (lacht) Ich wollte verhindern, dass das einer der «Ich geh mal rasch pinkeln»-Songs wird. Die Szene verrät aber auch viel über diesen Mann – wie er innehält, seine Klamotten mustert und sagt: «Ach du Scheisse, was mache ich hier?» Ich glaube, er hat in diesem Augenblick realisiert, dass er zu weit gegangen ist. Brown hat sich das angetan, um ein weisses Publikum anzusprechen.
«Say it loud, I'm black and proud!» James Brown war einer der ersten, der sich für die Rechte Farbiger in den USA einsetzte und gilt bis heute als eine Symbolfigur des schwarzen Selbstbewusstseins. Wie sehen Sie die Rolle schwarzer Musiker heute?
Ach, die Zeiten haben sich so geändert. Heute wollen die jungen Leute berühmt werden, und zwar sofort, und niemand kapiert, dass man dafür hart arbeiten muss. Ich befürchte, dass in zehn Jahren niemand mehr verstehen wird, dass man arm sein kann, obwohl man 20'000 Freunde auf Facebook hat. Was schwarze Stars die Jungen lehren können: Wenn ihr Erfolg haben wollt, arbeitet hart dafür!
Ein guter Punkt, den Sie selbst im Film allerdings gerade nicht machen. Es ist nie zu sehen, wie James Brown zum Musiker wird. Weshalb?
Seine Musik entstand instinktiv, er hatte ja keine Ausbildung im engeren Sinne. James Brown konnte zwar Trommel spielen, aber er konnte keine Noten lesen. Er konnte Musik nicht aufschreiben – nur ausdrücken, was er fühlte. James Brown war eine Fleisch gewordene Musiknote. Ich habe Aufnahmen seiner Recording Sessions abgehört, die sind sehr aufschlussreich. Wenn etwas nicht nach Plan lief, konnte er wahnsinnig sauer werden. Das kam sicher auch aus einer Unsicherheit heraus, weil er sich sprachlich nicht so gut ausdrücken konnte. Brown war ein Dirigent, wenn man genauer drüber nachdenkt.
Haben Sie noch einen Lieblingssong?
Man kann nicht einen haben! (lacht) «Night Train» mag ich wirklich. Wenn James Brown die Städte aufzählt, in denen er gespielt hat, sehe ich ihn wirklich vor mir, an all diesen Orten auf der ganzen Welt. Das ist seine Art zu sagen: Ich hab's geschafft, ich zähle etwas, die Leute mögen mich. Ich glaube, als er diesen Song schrieb, hat er zu sich selbst gesagt: «Du bist okay.»