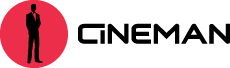Interview
Charly Hübner: «Ein Strich gegen einen Felsblock»

Was, wenn ein Hausmann und Vater nach Jahren zurück auf die Bühne des «richtigen» Berufslebens will? Schauspieler Charly Hübner über Debatten, Krisengebiete und das Aufmerksamkeitsproblem.

Schöne Idee, diese Roboterkostüme aus Karton für den Kindergeburtstag.
(lacht)
Pipi ins Tupperware, wenn's ganz dringend ist. Auch gut.
Toll.
Das ist sicher alles zuhause erprobt? Sie haben ja einen fünfjährigen Stiefsohn.
Ich habe die eigene Familie bewusst draussen gelassen, weil ich mich um die Kinder vor Ort kümmern wollte. Wenn ich versucht hätte, eine Erwartungshaltung in sie hineinzudenken, hätte das schon eine Enge hergestellt. Dann werden Kinder so, wie schlecht geführte Kinder in Filmen immer sind: aufsagend und beeindruckt von den Erwachsenen. Wir wollten leichte Kinder haben.
War das Ihr erstes Mal «frustrierte Ehefrau aus den 50ern»?
Das war insofern interessant, als dass man diesen Frust als Mann anders kanalisiert. Und dass die Erwartungshaltung eine andere ist. «Ich arbeite ab morgen. Daran musst du dich jetzt auch gewöhnen!» Schon lustig, dass das dann genau so kommt, wie man es von Muttern kennt. (lacht)
Der Vater als Hausmann, der im Grunde zur Mutter geworden ist: Kennen Sie persönlich Paare, bei denen die in Eltern angelegte radikale Umkehrung der Rollen hinhaut?
Ich kenne zwei Paare, die sich über Jahre immer abwechseln und das auch total offen kommunizieren. Aber in den meisten Fällen ist schon so, dass am Ende der Mann wieder die Schaufel in die Hand nimmt und die Frau das Handtuch. Und das ist total doof.
Eltern überzeichnet die herrschenden Verhältnisse ins Gegenteil, so richtig funktionieren will aber noch nicht mal diese Gleichstellung, von der so oft die Rede ist. Weshalb?
Ich habe mal den schlauen Satz gelesen: «Der Mann war über viele tausend Jahre damit befasst, aus dem Nest rauszugehen. Und die Frau saß zuhause wie die Innenministerin, hat die Hütte gepflegt und die Kinder groß gezogen.» Das ist jetzt total alttestamentarisch aufgerufen, aber ein Wissenschaftler hat geschrieben, es sei nachweisbar, dass Handlungen, die man immer wieder vollzieht, irgendwann zu genetischen Informationen werden. Wenn ich jetzt sehe: 150'000 Jahre machen wir das so? Schon mal rein von den Zeitfenstern, die wir nebeneinander stellen, ist das ein Strich gegen einen Felsblock. Trotzdem ist die Idee da, die nur entstehen konnte, weil wir aus Erfahrungen schlauer geworden sind. Das muss sich jetzt aber erst langsam in den gesellschaftlichen Körper hineinbetten. So wie jeder gute Regisseur den Schauspielern immer sagt: «Kriegt das jetzt mal in den Körper!»
Elternzeit, Väterzeit: In der liberalen Schweiz gibt's das alles nicht – die Mütter müssen nach 16 Wochen wieder arbeiten, der Vater sitzt einen Tag nach der Geburt wieder im Büro.
Die Debatte, die wir mit Eltern anstoßen wollen, ist ja eine total schlaue. Es wäre gut, wenn ein Ausgleich zwischen Männern und Frauen stattfände und dafür genügend Geld zur Verfügung stünde. Wenn aber eine Gesellschaft nur noch am kapitalistischen Wettkampf teilhaben will, wenn sich ein Land nur noch darüber identifiziert, die geilsten Produkte, die größten Exporte zu erwirtschaften, dann ist das Thema völlig obsolet. Dann schickt sie alle in die Spule und schafft Huxleys «Schöne neue Welt». (lacht)
Sie sind in der ehemaligen DDR gross geworden. Da war's normal, dass Vater und Mutter arbeiten. Wie gut war das für Sie?
Es war seltsam und im sozialen Gossip eher schwierig, wenn jemand Hausfrau war. Meine Mutter war krankheitsbedingt irgendwann Hausfrau, und da war man so: «Ach, deine Mutter ist Hausfrau.» Ich erinnere mich an wenig Freizeit mit den Eltern, man war von Anfang an in diesem Kreislauf drin, und wenn ich das richtig verstanden habe, brauchte der Staat natürlich auch beide Elternteile als Arbeitskräfte, um diese DDR wirtschaftlich auf einen grünen Zweig zu kriegen. Die Rechnung ist nicht aufgegangen. (lacht) Ich find's gut, wenn beide da sind. Ich habe als Kind total vermisst, dass der Vater nie da war. Im Sommer auf seine Schultern steigen und in den See springen – das fehlte mir einfach.
Haben Sie genügend Zeit, mit ihrem Sohn baden zu gehen?
So lange das wirtschaftlich geht, versuche ich, drei bis vier Monate im Jahr gar nicht zu arbeiten, einfach dazusein. Letzten Winter war ich vier Monate am Stück zuhause, und im Sommer nochmal einen. Das ist auch für mich ein Experiment, aus dieser antrainierten Attitüde rauszukommen, jeden Tag arbeiten zu gehen. Kann man machen. Aber wie schön ist es, wenn man dann auf einmal nicht muss.
Bei jungen Familien scheint wieder ein neo-konservativer Umschwung zu beobachten. Die Frau bleibt mit den Kindern zuhause, weil's organisatorisch einfach weniger anstrengend ist. Und auch billiger, wenigstens in der Schweiz.
Man muss schon sehr alternativ-liberal eingestellt sein, um das alles im Gleichschritt hinkriegen zu wollen. Und man muss auch kritisch zu diesem System eingestellt sein. Die entscheidende Lösung gibt es ja nicht. Es gibt eine gute Idee, und die versucht der Film auch zu vermitteln. Ist doch irre, dass dieser Konrad schon vor zehn Jahren gesagt hat, ich mach' das. Damals wurde das in dem tiefen Wald mal angesprochen – beim Lagerfeuer und im Weinrausch. (lacht)
Nehmen unsere westliche Selbstverwirklichungs-Egos ihre Jobs zu wichtig – ganz besonders die Männer?
Schwierig. Als Schauspieler hat man ja eine Meise. Das ist ja das Aufmerksamkeitsproblem, oder was auch immer. (lacht) Aber alles was man so hört in Gesprächen mit Bekannten. Denen geht's einfach darum, die Miete reinzukriegen. «Ist jetzt nicht mein Traumberuf, aber läuft super. Wir können uns jetzt das neue Auto kaufen.» Dieses Partizipieren am Kreislauf: Wir Darsteller und Schreiberlinge begeben uns ja in eine Position der Distanz zur Gesellschaft.
Prägen den Diskurs aber stark mit.
Da ist das Wichtigste, dass man sich einmal im Jahr selber auf die Schultern klopft. Man hat sich ja aus dem Kreislauf herausgezogen, und der schreit immer: «Komm zurück, komm zurück!»
Schöner Satz im Film, als das schwangere Kindermädchen sturzbetrunken in Ohnmacht fällt: «Ist nicht schlimm, wir müssen's halt einfach wissen.» Offenheit also. Was ist Ihnen in der Erziehung wichtig?
Der Junge soll sich zurecht finden können in der Welt. Jede Frage, die auftaucht, kann ich immer nur mit meinen Erfahrungen beantworten. Ich erzähle dann meistens Geschichten, weil ich als Kind so darunter litt, dass man so früh vorgefertigte Haltungen vermittelt bekommen hat, die ich teilweise bis heute nicht aus dem Kopf gekriegt habe. Ich will ihm nicht die Dogmen überstülpen, die ich in mir trage.
Was sind das für Dogmen?
Jedem die Hand geben und immer freundlich leicht nach vorne gebeugt grüssen. Jedem. Das ist furchtbar. Es gibt so viele Menschen auf dieser Welt, die einem nicht wohl gesinnt sind. Ein furchtbares Dogma. Auch: Dass man keinen eigenen Willen haben darf. Oder dass es immer einen Chef gibt, der einem sagt, was man zu tun hat.
Und dann sind Sie ausgerechnet Schauspieler geworden.
Ich wollte Sportler werden. Das ging aber aus gesundheitlichen Gründen nicht. Dann hab ich mich ein Jahr auf Sinnsuche gemacht, wollte auch Journalist werden. Aber nur Krisengebiete! (lacht)