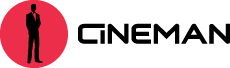Interview
Philipp Stölzl: «So viele Farben dazwischen»

Fast 27 Jahre hat es gedauert, bis der Bestseller von Noah Gordon den Weg in die Kinos fand: «Medicus»-Regisseur Philipp Stölzl über Groschenromane, Fascholeser und Ben Kingsley.

Sie waren 20, als Der Medicus 1986 erschien. So ein Bestseller: damals ein Thema für Sie?
Ich habe den so «strandschmökermässig» gelesen seinerzeit und mochte ihn sehr. Ich hatte immer schon ein Faible für historische Sachen. Mein Vater ist Museumsdirektor, ich bin mit Geschichte und Rüstungen aufgewachsen und habe einen Teil meiner Kindheit mit grossen Augen in den Asservatenkammern des Deutschen Nationalmuseums verbracht.
Ein süffiges Buch ist es ja. Streckenweise arg soapig?
Vom Plot her ist es Trivialliteratur, aber mit tollen Themen und tollen Weltbeschreibungen.
Die Geschichte eines blutjungen englischen Quacksalbers (Tom Payne), der beschliesst, sich im fernen Persien des 11. Jahrhunderts von Ben Kingsley zum Arzt ausbilden zu lassen: abenteuerlich abenteuerlich, aber auch mit Durchhängern?
Der Plot ist nicht gut gebaut. Was einen bei der Stange hält, ist diese unglaubliche Reise. Ob das jetzt religiöse oder geografische Lebenswelten sind, die dieser junge Mann da durchschreitet – das ist sehr gut recherchiert. Aber wie gesagt: Es ist klassische Populärliteratur. Was für einen Film nichts heisst: Die ganzen Hitchcocks sind ja verfilmte Groschenromane.
«Aber hallo, Herr Stölzl! Warum fehlt die Liebesszene im Kornfeld?» Fürchten Sie die bösen Briefe eingefleischter Gordon-Jünger, die eine buchstabengetreue Verfilmung ihrer «Bibel» erwartet haben?
Jetzt kommt er schon, der Fascholeser. (lacht) Es ist eben zum Beispiel so: Im Roman lernt Rob eine rothaarige Schottin kennen. In Konstantinopel sagt sie: «Heirate mich doch und werde Schafzüchter.» Er will aber der beste Mediziner der Welt werden und reist allein weiter. 300 Seiten später taucht sie plötzlich wieder in Persien auf. Er musste Jude werden, weil in Persien keine Christen erlaubt sind, um dort studieren zu können. Und dann gründet er mit einer rothaarigen Christin eine Familie?
Im Buch macht man das irgendwie mit – im Film nicht. Wir haben uns mit Noah Gordon über viele Dinge gezankt, aber nicht darüber. Es hat ihm sofort eingeleuchtet, dass man aus dieser Mary eine Jüdin machen muss.
Welche Ihrer chirurgischen Eingriffe in seinen Text haben Gordon denn nicht eingeleuchtet?
Zum Teil war das schon ein Weg. Er ist jetzt 87, das Buch ist Teil seiner DNA. Da ist es nicht leicht zu akzeptieren, dass das Ding im Film eine andere Form findet. Aber als Regisseur kann man so einem Buch nur im Geiste treu bleiben. Was treibt den Helden an? Was ist das für ein Mensch? All das braucht der Film auch. Aber die grossen Plotbögen, die ihn zusammenhalten, die muss man neu stricken. Das ist fast, als würde man in den Körper ein neues Skelett einbauen, das ihn besser zusammenhält. Gordon hat den Film am Ende umarmen können. Das war uns sehr wichtig.
Ihr «Medicus» ist eine deutsche Grossproduktion, die im Geiste und Gewande Hollywoods daherkommt – Noah Gordon wollte seinen Roman aber unbedingt auf «europäische Weise» verfilmt wissen.
Die Amerikaner hätten vermutlich versucht, das Thema Religion nicht oder nur schwach zu erzählen. Die hätten vermutlich auch versucht, die medizinischen Sachen auszusparen, die visuell schon eine gewisse Drastik haben. Das haben wir nicht gemacht, und das war auch in Gordons Sinne.
Im Film tönt ein englischer Akzent seltsamer als der andere – und jeder steht für eine nichtenglische Fremdsprache. Warum heisst der Film nicht gleich «50 Shades of English»?
(lacht) Horror. Das ist eine Mischung aus Wunschkonzert und reinem Pragmatismus. Ben Kingsley etwa wollte dieses Oxford-Englisch sprechen, er wollte keinen Akzent machen. Bei Olivier Martinez muss man schauen, was überhaupt mit seinem Englisch passiert. Und natürlich ist es bizarr, dass ein Schah einen französischen Akzent hat. Aber man muss auch sehen: Der Film läuft zu 95 Prozent synchronisiert.
Wie zufrieden ist der Sohn eines Historikers mit der erreichten Detailtreue?
Es gibt ja Filme, die aussehen wie Müll, aber die Geschichte fesselt einen so, dass es völlig Wurst ist. Der Medicus braucht diesen Detailreichtum, damit man dran bleibt. Entsprechend viele Mühen flossen da in jedes Skalpell, in jede Wand, die wir gebaut haben.
Sie pflegen Ihre Filme als «trojanische Pferde» zu verstehen: Welche unangenehme Wahrheit verbirgt sich im Bauche des Medicus?
Ich mag es, wenn Kino als episches Populärkino daherkommt, aber in seinem Inneren nochmal mehr Themen und Anliegen transportiert. Mich langweilt es immer, wenn man sagt, ein Film ist entweder E oder U. Es gibt so viele Farben dazwischen.
Noah Gordons «Medicus» ist echt eine Schmonzette, aber in anderen Schichten ist das Buch sehr philosophisch und politisch. Und auch ein bisschen Bildungsroman – für den Helden und für die Leser. Am Ende ist man auf jeden Fall klüger über das 11. Jahrhundert.