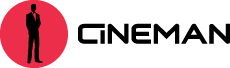Interview
Xavier Koller: «Mich hat der Schmerz interessiert»

Der Mann spricht ja schon, bevor er sich hingesetzt hat: Xavier Koller, letzter Schweizer Oscar-Gewinner, über Hollywood, Heimatfilme und Hasenscharten.

Ich habe den Satz von Ihnen gelesen: «Ich war ja nie weg, ich bin ja nicht ausgewandert.» Wo haben Sie denn die letzten 20 Jahre gesteckt?
Ich lebe schon in Los Angeles. Gemeint habe ich: Ich habe keine Berührungsängste mit der Schweiz, ich war ja oft hier. Wegen der Familie, aber auch, weil ich immer wieder hier gearbeitet habe.
Wenn ich wem erzählt habe, ich treffe Xavier Koller, war die Reaktion meistens: Was, der dreht noch Filme?
(Lacht) Ich habe für Disney gearbeitet.
Sie haben in Hollywood Filme gedreht – und keiner hat sie gesehen.
Ja, aus irgendwelchen Gründen. So wie es immer ist.
Frustriert?
Es hat mir schon gestunken, aber das hat viele Hintergründe. Disney ist eine grosse Firma, nach meinen Pocahontas zum Beispiel kam gleich der animierte Film heraus. Es gibt bei Disney zwei verschiedene Abteilungen, und die wussten nicht voneinander. Dann sagte man natürlich: Animation kostet zwar mehr, bringt aber längerfristig auch viel mehr Geld. Mein Film kam zwar ein paar Monate früher in die Kinos, aber mit dem andern haben sie ihn gleich zugedeckt.
Auch mal laut geworden im Stillen? Sogar den Oscar verflucht?
Das war nicht lustig. Aber es ist die Realität in Hollywood, und mit der muss man umgehen können, auch wenn es unangenehm wird. 15 oder 20 Millionen Dollar sind für einen Konzern wie Disney natürlich «Peanuts». Man hat mir schon vor dem Start gesagt: Erwarte nur nicht zu viel.
Schauen Sie sich die Oscar-Show noch an?
(Lacht) Zuhause in Los Angeles auf alle Fälle, da findet sie ja auch zu einer vernünftigen Zeit statt.
Wohin wäre Ihre Reise ohne den Oscar gegangen?
Es war jedenfalls nie mein Ziel, in die USA auszuwandern. Ich bin dort gern gereist, ich war oft drüben, meine Frau hat in den USA studiert, wir haben eine Tochter, die wird 16, sie ist die einzige Amerikanerin in der Familie.
Warum braucht Kurt Frühs grossartiger Dällebach Kari eigentlich ein Prequel?
Als man mit der Bitte an mich herantrat, aus Livia Anne Richards Theaterstück ein Drehbuch zu machen, sagte ich als Erstes: Ich will nicht erzählen, was man bereits kennt. Ich will das erzählen, das allenfalls zu dem führt, was man kennt: nicht die Legende, sondern wie Kari zur Legende wurde. Deswegen habe ich bei der Geburt angefangen. Und mich hat die Liebesgeschichte interessiert.
Ernste Frage: Tragen Sie in der Begräbnisszene gleich zu Beginn den Übervater zu Grabe?
(Lacht) Nein.
Ernsthafter gefragt: Wie ist Ihr Verhältnis zu Kurt Früh und seinen Filmen?
Ich habe Kurt natürlich gekannt, er hat ja sozusagen Hof gehalten damals. Er war eine Kapazität und hat super Filme gedreht – auch wenn man sich die heute anschaut.
Ihr Film unterscheidet sich in der Tonalität stark von Frühs Film. Gleichzeitig ist da eine augenfällige motivische Engführung, das macht schon der sehr feuchte Anfang klar.
Wasser ist natürlich ein Element des Lebens. Wasser hat immer mit Leben zu tun, ich arbeite gern mit Subtexten, die man nicht unbedingt verstehen muss. Das sind meine Leitplanken, damit ich überhaupt ein Gefühl für die Geschichte habe – für den dramatischen Bogen, für die Sequenzen. Ich denke nicht in Einstellungen, ich denke in Szenen und in Sequenzen.
Ich bleibe dabei: Da sind viele motivische Referenzen. War das Absicht?
Ich habe mir Frühs Film gar nicht angeschaut vorher. Aber alles, was man gesehen oder gelesen hat, setzt sich irgendwo fest und kommt dann beim Arbeiten rauf. Woher die Sachen kommen, weiss ich nicht. Ich denke und arbeite nicht so, das sind allenfalls unbewusste Referenzen, weil sei einfach in den Fluss der Geschichte hineinpassen und sich entwickeln. Die Ideen kommen ja nicht aus Büchern, die kommen aus dem Fluss der Arbeit heraus.
Ein buchstäblich massiver Eingriff: Ihr Kari lässt sich die Hasenscharte ausmerzen. Hat's diese Schönheits-OP gebraucht?
Das war mehr eine Referenz an unsere Eitelkeit. Wir gehen ja alle mit einer Hasenscharte durchs Leben, und dieses Verschönern nützt nicht viel, wir bleiben immer dieselbe Person. Man denkt, vielleicht ist es dann ein bisschen besser, aber es ist eigentlich eine ganz hilflose Aktion, die aber viel mit Sehnsucht und Hoffnung zu tun hat. Um diese Dinge geht es mir, die haben mit der Legende des Dällebach Kari gar nichts zu tun. Nur mit der Figur in meinem Film.
Was Ihrem sehr «cleanen» Film komplett fehlt, auch in der Rahmenerzählung, ist der Alkohol. Und damit die eigentliche Hauptfigur bei Früh.
Hat mich nicht interessiert. Der Alkohol war ein Resultat von Karis Schmerz. Mich hat der Schmerz mehr interessiert als der Alkohol.
Mit der Vorgeschichte rücken Sie die Jungen ins Zentrum. Ist das ein Film für die Jungen?
Aber natürlich. Gerade Carla Juri ist wunderbar, finde ich, auch Nils Althaus. Und die Älteren schauen sich vielleicht wieder einmal einen Film an, der mit ihrer Vergangenheit zu tun hat.
Störend fand ich, wie seltsam kindlich die Jungen miteinander reden: Hat das so getönt früher?
Die Beiden erleben ja einen ersten Frühling, alles spriesst, ist noch verspielt, naiv, unsicher, es ist nicht spekulativ, es ist herzlich. Und diese Verspieltheit, das Freisein von Konventionen, das ist das, was mir vorschwebte. Das Aufgeben von Konventionen und Erwartungen, man darf sein, wer man ist. Das ist doch der Idealzustand in Beziehungen und Liebschaften.
Interessieren Sie Kritiken noch?
Ich lese keine mehr. Ich kenne die Stärken und Schwächen meiner Arbeiten. Und meine Meinung zu meinen Filmen ist nicht gefragt, die muss ich ja niemandem ins Ohr flüstern. Primär muss sich das Publikum eine Meinung bilden, das ist mein Ziel: Ich drehe Filme fürs Publikum, möglichst ohne Kompromisse zu machen. Ich möchte eine Geschichte erzählen, die viel Herz hat und wie Kino daherkommt.
Der Schweizer Heimatfilm feiert ein Revival. Ist das eine gute Entwicklung?
Das gefrorene Herz, Der schwarze Tanner: Meine frühen Filme waren auch schon Heimatfilme – einfach auf eine andere Art. Sie verehren die Heimat nicht, wie das der Heimatfilm halt so macht. Aber sich mit der eigenen kulturellen und sprachlichen Identität auseinanderzusetzen: Das halte ich für eine gesunde Entwicklung. Man muss einfach aufpassen, dass man nicht immer enger wird. Und vor allem nicht engstirniger.
Und dass die Filme im Ausland komplett ignoriert werden.
Das Problem ist natürlich, dass wir so ein kleines Land sind. Und wir eine Sprache sprechen, die ausser uns niemand versteht. Die Sprache ist ja ein Ausdruck der Kultur. Aber Dürrenmatt sagte schon: Güllen ist eine Weltstadt, wenn man es richtig macht. Jetzt ist die Frage: Findet man die Geschichte, die aus Güllen hinauswächst. Da gibt es schon Ansätze. Giocci d'estate fand ich einen Superfilm. Oder auch Mary & Johnny.
In Ihrem Dällebach Kari fällt der Satz: Gebrauche deinen Witz und den klugen Kopf und nicht die feinen Fäuste. Kann man das auch dem Schweizer Film raten?
(lacht) Ja, definitiv.
Wohin geht Ihre Reise?
Als nächstes stehen Die schwarzen Brüder an – mit Moritz Bleibtreu in der Hauptrolle. Gedreht wird im Tessin, der grosse Happen im Studio in Köln.
Und wann kommt das Reise der Hoffnung-Sequel?
(Lacht) Man müsste jedes Jahr einen Film über dieses Thema drehen. Es wird ja immer schlimmer.