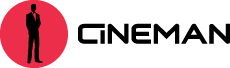Interview
«Die Schattenaufführung einer Liebesgeschichte»

Christian Petzold lässt in seinem neuen Film eine Auschwitz-Überlebende auf ihre verlorene Liebe treffen: der deutsche Regisseur über Zwischenräume, energetische Schlachtfelder und Nina Hoss.

Sie haben Phoenix am Filmfestival Toronto das Licht der Welt erblicken lassen und das damit begründet, es sei Ihnen wichtig gewesen, die grösstmögliche Distanz zwischen Ihren Film und Deutschland zu legen. Gibt es Distanz im digitalen Zeitalter überhaupt noch?
In Deutschland sind wir umgeben von Lehrfilmen über den Holocaust. Weil man den Deutschen beibringen musste, was sie gemacht haben. Ich wollte aber meinen Film mit Menschen sehen, die nicht schon eine Vorstellung haben, die sie anhand des Films abarbeiten. In Deutschland wird ein Film wie Phoenix erst auf seine Wahrhaftigkeiten und Wahrscheinlichkeiten abgeklopft.
Phoenix handelt von einem deutschen Musiker namens Johnny, der seine jüdische Frau Nelly während des zweiten Weltkrieges erst versteckt und dann verraten hat. Er denkt, sie sei im Lager umgebracht worden. Doch sie kommt nach Berlin zurück, sucht und findet ihn. Johnny kann sie aber nicht erkennen, weil ihr Gesicht nach einer Operation verändert ist. Er bietet ihr an, seine vermeintlich tote Ehefrau zu spielen, damit er an ihr Geld kommen kann. Durchaus nachvollziehbar, will diese Konstruktion nicht jeder kaufen?
Als ich den Roman («Der Asche entstiegen» von Hubert Montheilet, Anm. der Redaktion) gelesen habe, stellte ich mir dieselbe Frage. Aber für mich war sofort klar: Das sind Sätze von Samuel Fuller, Alfred Hitchcock oder George Stevens, die bei der Befreiung der Lager dabei waren. Die haben sich auch die Frage nach der Plausibilität gestellt. Wie ist das denn möglich? Das ist eine Frage, die sich auch auf die historische Situation bezieht, und um diese Frage geht es im Film. Für mich war immer logisch: Johnny kann Nelly gar nicht erkennen.
Weshalb nicht?
Weil er schuldig ist. Es gibt ein schönes Buch von Alexander Kluge. «Wer ein Wort des Trostes spricht, ist ein Verräter» heisst das, es sind 47 Texte zu Fritz Bauer, klassische Kluge-Geschichten. Die erzählen davon, dass von Seiten der Deutschen kein Wort des Trosts zu hören war. Dass es kein Umarmen gab. Dass für die Überlebenden keine Heimkehr möglich war. Dass es Jahre gedauert hat, bis die Existenz von Auschwitz überhaupt in Deutschland angekommen ist. Die Konstruktion ist die Eintrittskarte ins Kino. Ich sah sie auch nie als etwas Künstliches an, sondern als etwas Wahrhaftiges: Das Unwahrscheinliche kann ja wahrhaftig sein.
Das Unbehagen an der Konstruktion mag bei manchen auch daherrühren, dass man im Kino einen anderen Realismus erwartet als etwa im Theater. Ihr Film hat denn auch etwas Theatrales – in Anlage und Ästhetik?
Wenn man Sophokles liest und sich denkt: Es kann doch nicht sein, dass Ödipus sich nicht mehr daran erinnert, dass er den Mann an der Wegscheide umgebracht hat? Ich glaube, der Unterschied zwischen Theater und Kino ist nicht nur das Sujet – das Kino ist hauptsächlich in den Zwischenräumen beheimatet. Theater ist immer ein Tableau, das Kino aber hauptsächlich der Gegenschuss, der Zwischenraum zwischen Menschen und Intensität.
Phoenix ist dem Wesen nach ein Kammerspiel: Der wichtigste Raum im Film ist ein Keller, in dem Johnny Nelly wieder zu seiner eigenen Frau drapiert und dressiert, um mit ihr Geld verdienen zu können.
Dieser Kellerraum war für mich ein Labor, wie es ihn im Kino ganz oft gab. In den Frankenstein-Filmen. Oder in Les yeux sans visage. Oder in den Liebesfilmen der 50er und 60er Jahre von Douglas Sirk, die alle in Wohnungen spielen, die wie energetische Schlachtfelder daherkommen. Das ist für mich das Kino, und daran habe ich mich orientiert.
Soll man diesen Johnny sogar verstehen müssen? Auch er ist ja traumatisiert.
Dennis Hopper gibt in Der amerikanische Freund Bruno Ganz ein einziges Mal nicht die Hand – und dafür muss er sterben. Film und Literatur sind voller Geschichten, in denen eine leicht nachlassende Aufmerksamkeit, ein Verleugnen der Liebe schon in Nicht-Holocaust-Umfeldern dazuführt, dass ein Mann seine Frau umbringen will, weil er nichts mehr wert ist. Ich habe mich gefragt: Was passiert mit einem Liebesverrat unter extremen Bedingungen? Der Mann hat seine Frau jahrelang versteckt, der hat ja alles für sie getan. Und in einem einzigen Moment ist sein persönlicher Überlebenswille stärker gewesen als die Liebe, das ist der Verrat. Und dadurch erstirbt eine Liebe.
Eine Liebe, die aber Nelly umgekehrt dabei half, Auschwitz zu überleben. Weil sie etwas hatte, woran sie glauben konnte, wie sie einer Szene des Films sagt.
Sie kommt zurück und sieht, was sie dieser Liebe alles aufbürdet. Unter dieser Last ist der Mann zusammengebrochen. Meine Frau hat einen Film gedreht, der hiess Am Rand der Städte. Einen Film über Türken, die nach Deutschland gegangen sind, um ihr Glück zu machen, die all ihr Geld gespart haben, weil sie wussten, irgendwann gehen wir zurück und sind wieder glücklich. Womit sie nicht gerechnet hatten: Die Türkei ihrer Vorstellung gibt es nicht mehr. Ich will nicht sagen, dass das mit Auschwitz zu vergleichen ist. Aber in Extremsituationen baut man sich eine Blase wie ein Survival-Kit. Nelly glaubte an eine Liebe, die in dieser Intensität vielleicht gar nie dagewesen ist.
Oder eben doch: Man erkennt ja immer wieder, dass Johnny seine Frau sehr geliebt haben muss, ihr wieder zu verfallen droht, wofür es aber in seinem teuflischen Plan keinen Platz mehr geben kann. Da wären wir wieder bei Ihren Zwischenräumen?
Die Beiden spielen im Keller die ganze Liebesgeschichte noch einmal durch. Das könnte auch das Liebesnest eines Paares sein, das sich gerade kennen gelernt hat. Das fiel uns erst während des Drehens auf: Dass das ja eigentlich wie die Schattenaufführung einer Liebesgeschichte ist.
Ein Echoraum.
Das ist ein gutes Wort. Man kann erfühlen, was das gewesen ist. Ohne, dass die Figuren es aussprechen müssen, weil sie es selber vielleicht nicht mehr wissen.
Das ist bereits der sechste Film, für den Sie mit der grossartigen Nina Hoss gearbeitet haben. Ist es für einen Regisseur nur von Vorteil, wenn er «seine» Schauspielerin so gut kennt?
Wir kennen uns so gut, dass sie mir fremd geworden ist. Je mehr wir zusammen arbeiten, desto ferner ist sie mir, aber das im positiven Sinne. Beim Drehen von Phoenix fiel mir auf, dass sie den ganzen Film über wie neben sich spielt. Als ob sie immer zwei Figuren wäre, die nicht ganz zur Deckung kommen, es ist so eine Unschärfe in ihr, eine Unsicherheit. Aber plötzlich fängt sie im Keller an, den Mann zu inszenieren.
Eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass sie zu einer neuen Frau werden kann.
Nelly erkennt, dass sie nicht einfach die Frau ist, die durch den Mann wieder zu ihrer Identität kommen will, sie merkt, dass das nicht mehr möglich ist. Im Grunde wird sie modern, zu einer erwachsenen Frau. Was nicht ohne Verluste geht. Der Verlust ist vielleicht, dass man nie wieder unschuldig ist. Nelly wird nie wieder romantisch sein. Sie erkennt, dass sie dem Mann eine so grosse Definitionsmacht über sie zugesteht, dass sie einsieht: Das kann nicht meine Identität sein. Interessant fand ich, dass diese Liebesmetaphorik auch etwas Politisches haben kann.
Nelly fehlt im Film ein Spiegelbild – dafür haben Sie in Johnny eines, der ja nichts anderes ist als ein Regisseur. Eine wohl nicht immer nur angenehme Erfahrung?
Das war erstaunlich und furchtbar, weil ich die ganze Zeit damit beschäftigt war, den Unterschied zwischen ihm und mir herzustellen. (lacht) Mann inszeniert Frau: Das ist natürlich eine Geschichte, die ganz tief in der Geschichte des Kinos drinsteckt. Regisseur und Muse, männliche Band mit Sängerin, der Maler und sein Modell, Alfred Hitchcock und Tippi Hedren oder Grace Kelly: Das ist überall die ähnliche Konstruktion. Da spielt der Film auch ein bisschen Kino vor.
Hat Phoenix also auch Ihre Selbstwahrnehmung verändert?
Das Hauptsächliche war für mich, dass es eine Ordnung gibt, gegen die man angehen kann. Ich wusste ungefähr, wie der Film aufhört, aber ich wusste nicht, wie man das erzählt. Und dann habe ich gemerkt, dass wir mögliche Enden schon in den Film eingearbeitet hatten. Dass die Nelly eine Pistole hat, zum Beispiel.
Die Pistole ist ein mögliches Ende ...
... das aber nicht mehr möglich ist, weil es Auschwitz ist. Mit Auschwitz enden die Erzählungen in der klassischen Form. Der Film lässt drei möglichen Enden vergehen, weil wir die Geschichte so nicht mehr zu Ende erzählen können. Das ist dann, wenn ich am liebsten Musik einsetze im Film: Wenn das Symbolische nicht mehr funktioniert, aber irgendetwas ist noch da, dann fängt die Musik an.