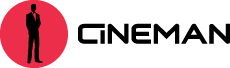Interview
Jake Gyllenhaal: «Nicht immer ein Vergnügen»
Spielt in «Nightcrawler» einen Videoreporter, der das Fernsehen mit Bildern von Unfällen und Verbrechen versorgt: Jake Gyllenhaal über Erfolgshunger, Leitungswasser und Kojoten.

Mr. Gyllenhaal, genau vor einem Jahr haben wir uns das letzte Mal gesehen, als Sie, ebenfalls hier auf dem Filmfestival von Toronto, den Thriller Prisoners vorstellten ...
... und parallel dazu fing ich an, mich mit Nightcrawler zu beschäftigen. Zwischen den Interviews habe ich wie verrückt Dialogzeilen auswendig gelernt, denn ich wusste: Wir haben nur 25 Drehtage, ein sehr kleines Budget, es muss alles sitzen. Nach Toronto sass ich im Flieger und habe elf Stunden am Stück Zeilen gebüffelt.
Ehrlich gesagt, Sie sahen damals irgendwie anders aus, wohlgenährter.
(lacht.) Es war auch die Zeit, als ich begonnen habe, mich körperlich auf die Figur einzustimmen.
Sie meinen, Sie haben Diät gemacht?
Ja, und Interviews zu geben, hat dabei sogar geholfen, denn das war eine gute Ablenkung. Obwohl, ich habe immer die Journalisten gesehen, wie sie das Buffet plünderten, und ich stand hungrig daneben.
Sie spielen in Nightcrawler einen «Bluthund», einen Videoreporter, der das Frühstücksfernsehen mit Schockbildern von Unfällen und Verbrechen versorgt. Wieso mussten Sie dafür so dünn sein?
Mein Vorbild für die Figur war ein Kojote. Ich wollte meinen Körper kojotenhaft formen. Ich bin ganz viel rennen gegangen.
Wie, ein Kojote?
Doch, ich habe wirklich versucht, einen Kojoten zu imitieren. Ich bin nur noch gerannt, die ganze Zeit, manchmal 13 Kilometer am Tag, machmal 25 Kilometer. Auch zum Set bin ich gerannt. Es gab Tage, da kam ich rennend aufs Set und bin ohne zu duschen direkt in die Szene rein. Wir haben ja meistens in der Nacht gedreht, in Silver Lake und Echo Park, Los Angeles, manchmal in Santa Monica, und nach Drehschluss, gegen sieben Uhr früh, ging ich oft auch wieder rennen. Ich bin zum Beispiel durch den Griffith Park gerannt, da gibt es viele Kojoten. Das fühlte sich an, als würde ich im Rudel rennen. Ich sass in der Maske und hatte wirklich das Gefühl, mich in einen Kojoten zu verwandeln.
Aber wieso das Ganze?
Es gibt eine Restaurant-Szene, die es nicht in den fertigen Film geschafft hat, da fragt meine Figur, Lou, was die Extras für den Burger kosten: «Was kostet Käse? Was kostet Speck?» Am Schluss bestellt Lou den einfachen Burger und ein Leitungswasser. Mehr kann er sich nicht leisten. Er ist also wirklich hungrig, aber auch im übertragenen Sinne: erfolgshungrig. Und Kojoten starren einen ja immer so an, als würden sie dich fressen. Lou isst seine Mitmenschen auch geradezu auf, wie Abfälle. Der Mann ist ein Tier. Dan ...
... Gilroy, der Regisseur ...
... sagte: «Los Angeles ist diese Riesenmetropole, doch umgeben ist sie von Wüste und wilder Natur, wilden Tieren, die in der Nacht in der Stadt herumstreunen. Lou ist wie so ein Tier.»
Waren Sie zur Vorbereitung mit den echten Bluthunden unterwegs?
Ja, ich wusste allerdings schon vorher ein stückweit, wie es abläuft, denn ich habe ja den Film End of Watch gedreht und damals war ich mit Polizisten auf Streife. Da kamen wir ganz oft an einem Tatort an und plötzlich tauchte ein Van auf und ein Kerl mit einer Kamera sprang heraus.
Nun waren Sie selber in einem solchen Van unterwegs?
Genau, ich bin ein paar Nächte mit diesen Reportern mitgefahren, das war sehr faszinierend. Die sitzen im Van und hören auf 15 Kanälen gleichzeitig irgendwelche Polizeifunks ab. Es sind sehr, sehr aufmerksame Typen. Auch deshalb war der Kojote ein so guter Referenzpunkt: Diese Typen hören alles, sie riechen alles. Sie haben zudem etwas Kindisches.
Wie meinen Sie das?
Es ist wie bei Kindern, die sich schlagen und dann ganz fasziniert sind: «Oh, Blut!» Ich sage nicht, dass sie die Konsequenzen ihres Handels nicht verstehen, aber es sind sehr verspielte Leute. Das macht sie so interessant – und so erschreckend. Doch sie sind, wohlgemerkt, nur die Überbringer der Nachrichten. In der Welt, aber ganz besonders in Los Angeles, existiert eine Fernsehindustrie, die sich aus Tragödien speist. Ich frage mich: Woher kommt dieses Bedürfnis von uns Zuschauern? Aber auch: Woher kommt dieser unbändige Erfolgshunger in Leuten wie Lou? Nightcrawler ist ja nichts anders als eine Erfolgsstory. Es ist die Geschichte von der Geburt eines Unternehmers, eines Selbstvermarkters. Lou sagt: «I'm not a business man. I'm a business, man!»
Sie verurteilen diese Leute also nicht?
Nein, bestrafen wir nicht den Überbringer der schlechten Nachrichten. «Don't shoot the messenger!» Diese Leute werden übrigens tatsächlich oft angeschossen. Wenn sie vor der Polizei am Tatort sind, kann es vorkommen, dass die Täter noch da sind und auf sie schiessen. Ein Typ hat mir auch Aufnahmen gezeigt aus einem Buschfeuer. Er war so nahe dran an dem Feuer, dass er fast verbrannt ist, aber auf den Aufnahmen hört man ihn rufen: «So eine schöne Aufnahme, so schön!»
Können Sie den Adrenalinkick nachvollziehen?
Den Kick irgendwie schon, aber der Job wäre trotzdem nichts für mich. Ich brauche meinen Schlaf. (lacht.)
Standen Sie nicht manchmal an einem Unfallort und dachten: «Leute, legt die Kameras weg! Es gehört sich nicht, so etwas zu filmen.»
Diese Frage stellt sich doch immer im Journalismus: Ist man nur ein Berichterstatter, oder muss man manchmal einschreiten, helfen ...? Aber, ja, natürlich, ich stand daneben und ich dachte genau dies.
Ist Lou ein Produkt unserer Zeit?
Auf jeden Fall. Er ist ein Teil dieser irrsinnigen Nachrichtenmaschinerie. Ich schaue die Nachrichten und ich staune über den Informationsfluss in der Endlosschleife. Ich bin ja auch ein Teil davon. Zum Beispiel hier auf dem Filmfestival: Ich gebe manchmal derselben Person drei Interviews. Zuerst reden wir über den Film, danach reden wir über die Reaktionen zum Film, und dann darüber, was ich über die Reaktionen auf die Reaktionen denke! (lacht.)
Macht es eigentlich Spass, einen solchen Typen zu spielen?
Um ganz ehrlich zu sein: Es war nicht immer ein Vergnügen. Sich in ein so verdrehtes Hirn hineinzuversetzen, ist nicht angenehm. Manchmal fühlte ich mich wirklich ein bisschen mies.
Konnten Sie sich nach Drehschluss schnell aus so der Rolle ausklinken?
Nein. Es dauert eine Weile, bis man sich einer solchen Geisteshaltung entledigt hat. Aber auch die physischen Gewohnheiten, etwa rennen zu gehen, oder die Diät – das musste ich mir erst wieder abgewöhnen.