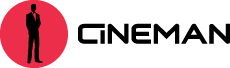Interview
Ulrich Seidl: «Es soll möglichst natürlich wirken»

Sein neuer Film «Im Keller» bringt Licht ins Dunkel der österreichischen Unterwelt – wir haben ihn in seiner Wiener Küche getroffen: Ulrich Seidl über Bierdeckelsammlungen, Hitlerverklärer und Humor.

Wie sieht es eigentlich in Ulrich Seidls Keller aus?
Der Keller von mir ist ein Keller in einem Landhaus, und ist ein alter, in den Felsen gehauener Keller, in dem ich Wein lagere.
Aber keine Filmrollen.
(lacht) Die lagere ich lieber auf dem Dachboden.
Wien bei Tag, 9. Bezirk: eine noble Gegend, eigentlich, aber davon ist beim Ausstieg an der U-Bahn-Station Friedensbrücke nicht viel zu sehen. Zur Rechten liegt ein unschön grauer Donaukanal, links rauscht der Strassenverkehr Richtung Innenstadt. Ein erster Augenschein in Ulrich Seidls engerer Arbeitswelt? Eine in schmutzigem Gelb gehaltene Blockrandsiedlung aus den fünfziger Jahren ist nach Sigmund Freud benannt. Wolfgang Amadeus Mozart ist hier nicht überall als weltberühmte Pralinenkugel erhältlich, sondern ein mittelklassiges Hotel. Und ein Stück Donau-abwärts stösst der Kamin der städtischen Fernwärmeanlage an die Tiefnebeldecke. Im Gasthaus Orlik, einige Strassenzüge weiter, sind Wildbretwochen, die saison-gerechte Ganslsuppe steht auf der Speisekarte, und der eingeborene Wiener wird wissen, worauf er sich einlässt, wenn er «Blunzengröstl» bestellt, das hier mit Spiegelei aufgetragen wird. Österreich, immer wieder, dieses schrullige Marillenland: kulinarisch wie sprachlich an jeder zweiten Ecke ein verblüffend fremdes Ereignis und so anders-deutsch, dass man auch bei Seidls Filmen heimlich aufatmet, wenn sie mit Untertiteln in die Kinos kommen – und seien es nur die englischen.
Für seinen neuen Film ist Ulrich Seidl in Österreichs Unterwelt hinabgestiegen; auch schon, bevor sie durch die Priklopils und Fritzls zweifelhafte Weltberühmtheit erlangte. Die Hobbykeller, die Partykeller, der Mann mit der Modelleisenbahn – alle haben sie in Seidls, nun ja, Dokumentarfilm ihren Platz: als mal erschreckende, mal nur erschreckend normale Ansichten eines Alltags. Jene fragile Zone zwischen Scherz und Schmerz; dort, wo das Heimliche ins Unheimliche kippt – hier ist Seidls «Keller» zuhause. Gestatten: Ein Mann beim Schwimmen in seinem Pool, der nur unwesentlich länger ist als sein crawlender Besitzer – ein Sisyphos beim Bade. Drei Frauen neben einer Waschmaschine stehend, die einen so lange anstarren, dass man beschämt den Blick abwendet. Aber eben auch, und das sind die Menschen und Räume, die in diesem Film den grössten Platz beanspruchen: Ein Mann, der gerne Opernsänger geworden wäre, aber jetzt einen Schiesskeller führt. Ein Hitlerverklärer, der nur zum Essen in die eigentlichen Wohnzimmer seines Hauses hinaufsteigt, die man konsequenterweise nie zu Gesicht bekommt. Und: Eine Frau, die sich ihren Mann als Sexsklaven hält, der ihr das Klo sauberleckt, wenn sie sein Gemächt nicht gerade mit Gewichten behängt. Auch der neue Seidl also: sehr explizit und ziemlich deftige Feinkost.
Er wollte, sagt der Regisseur im ersten Geschoss eines grauen Bürgerhauses, in dem er seine Produktionsfirma untergebracht hat, «Mezzanin» steht neben der Klingel, die österreichische Bezeichnung für Zwischengeschoss, der Eingang zwar hoch und hell, und doch taucht der Besucher hinter der schweren Türe in das funkelnde Dunkel einer Welt von gestern, er wollte, sagt er also, «den Keller als Ort der Freizeit, des Harmlosen zeigen; wissend aber, dass der Keller immer auch der Ort des Abgründigen ist. Der Keller steht auch für ein Doppelleben – äusserlich wie auch symbolisch: Wir tragen ja alle ein Doppelleben ins uns.»
Sie bezeichnen Im Keller als Essayfilm. Der deutsche Autor Hans Magnus Enzensberger hat einmal gesagt, er verstehe unter Essay einen «diskursiven Text, bei dem ich am Anfang noch nicht weiss, was am Schluss dabei herausspringt». Sehen Sie das ähnlich?
(denkt lange nach) Ich wehre mich ja schon seit längerem gegen die Bezeichnungen Dokumentarfilm und Spielfilm. Essayfilm heisst: Man hat eine Meinung zu einem Thema, in einem Essay äussert sich eher der Autor. Unter Dokumentation versteht man landläufig – obwohl ich finde, das stimmt auch nicht: Hier bekommt man genau das serviert, was die Wahrheit ist. (lacht) Da sind wir schon bei den schwierigen Themen. Der «Keller» hat ja in Österreich einen ziemlichen Skandal provoziert.
Zwei ÖVP-Politiker mussten zurücktreten, nachdem bekannt wurde, dass sie im Keller eines Hitlerverharmlosers als Statisten mitwirkten.
Letztendlich ist es in den Medien zur Frage gekommen: Was darf man als Regisseur im Dokumentarfilm? Haben Sie den Leuten gesagt, was Sie tun sollen? Welche Anweisungen haben Sie den Leuten im Keller gegeben?
Haben Sie denn nun das Hitler-Porträt in diesen Nazikeller gehängt, das sein Bewohner Josef Ochs sein «schönstes Hochzeitsgeschenk» nennt?
(ironisch lachend) Genau.
Statisten in einem Dokumentarfilm? Das ist exakt eine der Fragen, die Sie mit Ihren Filmen immer schon provoziert haben.
Ich lerne die Menschen wochenlang, manchmal monatelang kennen, verbringe mit ihnen Zeit und beobachte, was sie tun. Aus dieser Erfahrung heraus sage ich ihnen beim Dreh dann, was sie tun sollen.
Ein anderes Beispiel für die «Methode Seidl»: Die Dame, die sich in ihren Keller einschliesst und Puppen aus Kartonschachteln packt, als wären sie echte Babys, soll solche Puppen tatsächlich besitzen – allerdings als Ausstellungsobjekte in ihrer Wohnung. Wie kommt diese doch dramatische fiktionale Verschiebung zustande?
Im Nachdenken darüber, was diese Frau in ihrem Keller – und es ist wirklich ihr Keller, und es sind ihre Puppen – tun könnte, bin ich auf diese Geschichte gekommen und habe sie sie spielen lassen. Das geht aber nur unter der Voraussetzung, dass sich diese Frau in das, was sie da tut, hineinfühlen kann. Sonst funktioniert das nicht. Ich würde von Darstellern nicht verlangen, dass sie irgendetwas tun, das ihnen völlig fremd wäre. Diese sogenannte Dokumentarfilmmethode habe ich früher auch schon angewendet: Dass man im Sinne des Darstellers, im Sinne der Geschichte, Dinge auch weiterführt. Sie fiktionalisiert.
Er erfinde, so viel er könne, sagt Werner Herzog über seine Dokumentarfilme. Wo verläuft die Grenze Ihres Inszenierens?
Wie soll man die Grenze festlegen? Die Grenze liegt dort, wo man sie selber festlegt – und in meiner Verantwortung gegenüber den Darstellern. Wenn ich glaube, dass jemandem die Würde genommen wird, oder dass jemand in etwas hineingetrieben wird, wofür er sich später geniert, wenn er etwas nicht will oder es nicht seines ist, dann mache ich das nicht. Das ist die Grenze für mich.
Eine eigene Meinung zu haben, wie Sie sagten, kann aber nie heissen, dass Sie eingreifen, wenn Sie – wie in einer der Szenen im Schiesskeller – drei Herren über die Minderwertigkeit des Türken reden lassen?
Nein, das hat keinen Sinn. (lacht) Das entsteht ja so: Ich verbringe im Vorfeld viel Zeit in dem Schiesskeller. Da gibt es Menschen, mit denen ich ins Gespräch komme; und wenn ich ungefähr weiss, was die sagen, frage ich sie, ob sie eine Szene zu einem bestimmten Thema sprechen wollen.
Und dann lassen Sie sie von der Leine.
Ich schaue, dass es möglichst natürlich wirkt, zum Beispiel. Aber ich gebe ihnen keinen Text vor.
Was Sie falsch finden: Dass man mit dem Finger auf diese Leute zeigt.
Ja. Aber es gibt natürlich Zuschauer, die sich selber ausnehmen und sagen: „Ah, der da!“ Weil sie eine Wahrheit nicht zulassen – aus Angst. Oder weil ihnen das zu nahe geht. (lacht)
Wie nahe kommen diese Menschen Ihnen?
Sehr nahe. Ich muss mich für diese Menschen interessieren, sonst interessiert mich die Arbeit auch nicht.
Haben Sie im idealen Keller gestanden, aber er hat keine Geschichte erzählt?
Das Meiste, was Sie finden, ist zunächst belanglos. Sie brauchen irgendwo einen Ansatz – einen Mensch, der da ist und sich öffnet. Wenn mir jemand nur seinen Keller und seine Bierdeckelsammlungen zeigt, dann ist das ja noch nichts.
Ulrich Seidl rührt in seinem Kaffee, den er so schwarz trinkt wie er sich kleidet: schwarzes Jacket, schwarze Stoffhose und Lederstiefel, eine verwegenes Exemplar für den gediegenen Grossstadt-Cowboy, der ein bisschen mit dem Chic des Zuhälters liebäugelt. Die Küche, in der er den Besucher empfängt («Sind sie angereist, extra?»), verrät, kein Wunder, das Auge des Ästheten. Das warme Licht einer alten Lampe erfüllt den Raum, den ein wackeliger Holztisch dominiert, auf dem süsses Gebäck und weisses Teegeschirr stehen; es ist ein bisschen, als käme man heim zu Grossmuttern. Die Ledercouch mit der zerschlissenen Sitzfläche – Seidl wird beim improvisierten Fototermin danach erst ein Kissen auflegen müssen, um nicht zu tief einzusinken – und der hohen Rückenlehne könnte in einem Kloster gestanden haben.
Oh, ein Seidl-Bild! Das Haupt des Regisseurs vor dem Herrn, der über ihm an der Wand hängt: Erich von Stroheim, finster blickend, er hat den Kopf in Denkerpose aufgestützt, seine rechte Hand umklammert einen Gehstock. Neben dem Tisch steht ein schmales Regal mit Filmen auf DVD, keine Seidls darunter, auf dem Holzbuffet stecken ein paar Grappaflaschen ihre Zapfenköpfe zusammen, und auf dem Fenstersims thront, gleich zweifach, Valie Exports Miniatur-Wendeltreppe aus Gussbeton, die nach oben und ins Nichts führt. Das ist der österreichische Filmpreis, bei Seidl in bester Gesellschaft zahlloser Festival-Trophäen. Zeugen des Erfolgs – Zeit für ein paar grundsätzliche Fragen.
Woher kommt Ihre Liebe zum Tableau?
Ich weiss nicht. Schon die erste Einstellung in meinem ersten Kurzfilm war ein Tableau: Ein Zwergwüchsiger steht in einem Kornfeld, das ihm bis zur Brust geht, und sagt ein Gedicht auf.
Diese Köpfe, die auf dem unteren Bildrand liegen: ein Seidl'sches Markenzeichen, das nirgends stimmiger war, als in Ihrem Gebetsfilm Jesus, du weisst.
Das hat sich so entwickelt. Das ist mein Blick einfach. Ich versuche ja auch, durch Räume etwas zu erzählen.
Menschen herzeigen – aber bloss nie fragen, warum sie so geworden sind! Warum interessiert Ulrich Seidl das Warum nicht?
Ich versuche keinesfalls, psychologisierende Filme zu machen. «Aha, der Mensch ist jetzt so, weil er in seiner Kindheit das und das erlebt hat!» Das ist mir zu einfach. Der Zuschauer hat viel mehr davon, wenn er dazu aufgerufen wird, das, was er sieht, auf sich beziehen zu müssen. Ich will, dass der Zuschauer mit dem, was er sieht, sich selbst zuschaut. Auch wenn das am Anfang schmerzhaft ist: Es kommt ja zu einer Erkenntnis, und die ist dann wieder befreiend. Dafür sind viele Leute auch dankbar.
Welche Rolle spielt Thomas Bernhard in Ihrem Sehen und Gehen? Einer seiner autobiographischen Texte heisst ja zufälligerweise «Der Keller».
Ich fühle mich ihm sehr verwandt, weil auch er unangenehme Wahrheiten zum Thema macht – wie ich mit viel Humor. Wenn ich Bernhard las, habe ich oft wirklich laut lachen müssen. Ich hätte auch wahnsinnig gerne einen Film über ihn gemacht, habe es aber leider versäumt.
Sie sind zu einer Marke geworden. Bernhard hat die damit verbundenen Schwierigkeiten in seinem kurzen Text «Der Stimmenimitator» beschrieben. Der kann zwar jeden Anderen perfekt nachahmen, ist aber nicht in der Lage, sein eigenes Reden zu imitieren. Wie halten Sie es mit der Erwartung, die man an den Provokateur Seidl heranträgt? Mit dem Nazikeller wiederholen Sie doch nur das alt-bekannte Bild jenes Österreichs, das seine Vergangenheit nie aufarbeitete.
Ich mache nie Filme und habe dabei das Publikum im Kopf. Ich denke nie an das Publikum, wenn ich Drehbücher schreibe. Wenn man das macht, zensiert man sich. Mit dem Nazikeller wollte ich sagen, dass es irgendwie normal ist, dass es so etwas gibt. Die Leute im Ort wissen davon, man geht da aus und ein. Das ist ein Beispiel für das Bewusstsein, das in Österreich noch immer vorhanden ist. Diese nicht aufgearbeitete Vergangenheit, die nostalgisch betrachtet wird, finde ich sehr österreichisch.
Sie zeigen den Keller als Ort, an dem die Leute bei sich sind, zu sich kommen. Würden Sie sagen: Etwas auszuleben ist in jedem Falle weniger schlimm, als geheime Wünsche unbesehen in einem Kellerloch wegzusperren?
Schlimm oder nicht – das ist so eine Frage. In Deutschland gibt es Neonazis, die sind gefährlich, weil sie Leute ermorden. In dem Sinne ist Josef Ochs nicht gefährlich, er ist kein Wiederbetätiger. Aber es ist auch nicht ungefährlich, diese Vergangenheit zu verherrlichen. Österreich war gar nicht schuld, wir sind von Hitler überfallen worden: Diese Ansicht ist in Österreich latent vorhanden.
Denken Sie, wenn Sie einem Menschen begegnen: Wie sieht wohl sein Keller aus? Der Keller, das wahre Gesicht des Menschen?
(lacht) Nein, das denkt man nicht. Aber natürlich, man könnte den Film endlos weiterdrehen. Es geht ja bei mir letztlich immer um die Auseinandersetzung mit der menschlichen Existenz, mit all diesen grossen Fragen, die immer auch da sind: nach der Einsamkeit, der Sinnhaftigkeit, der Liebe, der nicht entdeckten Liebe. Genau so könnte man den Film Tierische Liebe immer wieder weiterdrehen.
Da kommen Sie aber nicht in Versuchung?
Irgendwann ist es für einen erledigt, und man sucht weiter.
Er muss jetzt gehen. Seidl stiefelt hinüber in sein Büro, die Türe bleibt offen. Ein Tisch ist zu sehen, auf dem Bücherberge sich erheben, dazwischen ziert sich eine rote Madonna in einem Glaskasten. Da steht er, vertieft, in ein nächstes Projekt, vielleicht, das ein historischer Spielfilm werden wird.