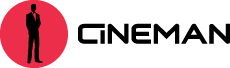Interview
«Realismus finde ich schrecklich langweilig»

Ihr Spielfilmdebüt wurde am ZFF 2013 gleich als «bester deutschprachiger Spielfilm» ausgezeichnet: «Finsterworld»-Regisseurin Frauke Finsterwalder über Komik, Haare im Abfluss und Bärenkostüme.

Wir führen dieses Gespräch nicht wie geplant in Zürich, sondern per Mail. Deshalb zum Auftakt die eher ungewöhnliche Frage: Wo und wie darf ich Sie mir im Augenblick vorstellen?
In einem schwäbischen Krankenhaus, liegenderweise.
Ihr schöner Name, Frau Finsterwalder, gibt für Finsterworld ja gewissermassen die Perspektive vor: Wie pessimistisch wäre Ihr Blick auf Deutschland ausgefallen, wenn Sie etwas fröhlicher hiessen?
Ohne meinen Nachnamen hätte der Film natürlich nicht so einen schönen Titel bekommen können. Das wäre sehr schade gewesen. Und so pessimistisch finde ich Finsterworld gar nicht. Er ist doch streckenweise auch sehr komisch.
Hartz IV-Bezüger beim Essen vor dem Fernseher filmen, aber zum Schluss einen Funken Hoffnung schlagen: In Finsterworld entwirft eine Dokumentarfilmerin, die vielleicht unsympathischste Figur des Films, das Programm eines «neuen Neorealismus». Halten Sie dem, es nimmt ja fast jede Geschichte in ihrem Episodenfilm die schlimmstmögliche Wendung, die Poetik eines «skurrilen Realismus der Hoffnungslosigkeit» entgegen?
Realismus finde ich schrecklich langweilig. Man geht ja eigentlich ins Kino, um die Welt mal anders zu sehen, als man sie jeden Tag sowieso sieht. Deswegen sieht in Finsterworld alles übertrieben schön aus. Es scheint die ganze Zeit die Sonne. Und es ist ja zunächst ein sehr lustiger Film. Eine Komödie, die dann irgendwann zum Horrorfilm wird. Um so eine Geschichte zu erzählen, kann man nicht einfach die Realität abfilmen. Ich habe mich also eher an Comics wie zum Beispiel «Ghost World» orientiert.
Alles so düster hier: Steht es so schlimm um dieses Deutschland, das sich – zumindest auf bundespolitischer Ebene – spätestens seit der Fast-Pleite Griechenlands als strahlender Leitstern Europas in Szene setzt? «Dort oben» scheint alles hell, aber «ganz unten», unter dem Beton, mit dem man nach dem Krieg «die deutschen Städte zugeschmiert hat», wie es einmal heisst, liegen eben immer noch vor allem Nazitrümmer?
Ja, so erscheint es mir zumindest. Mir ist diese neue, selbstbewusste Rolle der Deutschen sehr unangenehm. Oder das Aufkeimen der alten Rolle. Aber das ist natürlich meine subjektive Sicht. Der Film heisst ja nicht Deutschland, sondern Finsterworld.
Sie leben im Moment in Florenz und Afrika – weiss die «Wikipedia». Wie gross ist die Gefahr, dass man sich von da aus aus unangemessener Distanz durch Deutschland bewegt, etwa so wie im Film die Sandbergs, jenes linkshedonistische Ehepaar, das in seiner Luxuslimousine nichts hört als das Schnurren des Motors – und sein eigenes?
Im Moment befinde ich mich ja in einem deutschen Krankenhaus. Und von hier aus betrachtet erscheint mir Finsterworld wirklich viel zu zart gezeichnet.
Im Film wird rein zufällig ausgerechnet ein hoffnungsvoller Internatsschüler erschossen – er hat aus Liebeskummer den KZ-Besuch mit der Schule geschwänzt. Wie ironisch ist das denn?
Das ist wohl eher tragisch als ironisch zu nennen.
Und wie ernst soll man nehmen können, dass ein verliebter Fusspfleger, der für seine Angebetete im Altenheim liebevoll Cookies aus dem Abrieb ihrer eigenen Hornhaut bäckt, die einzige wirklich freundliche Figur in Finsterworld ist?
Sie meinen Claude, wunderbar gespielt von Michael Maertens? Ja, der ist wirklich, trotz seiner dunklen Seite, eine sehr sympathische Figur. Vielleicht der einzig sozial intakte Mensch in dem ganzen Film. Sehr liebenswert. Übrigens erzählte mir eine Schweizer Psychologin auf dem Züricher Filmfest, dass es das wirklich öfters gibt. Menschen, die zum Beispiel die Haare Fremder aus dem Abfluss fischen und verbacken und essen. Da war ich fast ein bisschen traurig, dass der Claude gar nicht so wirklich unsere Erfindung ist, sondern, dass es Menschen mit dieser Neigung anscheinend zuhauf gibt.
Diese Mischung aus peinlicher Berührtheit bei gleichzeitiger leiser Ehrfurcht für die reinliche Liebe, die das bei mir auslöste, hat mich von ferne an Miranda July erinnert, die in The Future phasenweise in ganz ähnliche Problemzonen vordringt. Mögen Sie die?
Ja, ich mag Miranda July. Sie ist sehr selbstironisch, das gefällt mir.
Jakub Gierszal, im Film als faschistoider Internatsschüler Maximilian zu sehen, erinnert zwar auch an Michael Pitt in Michael Hanekes amerikanischem Funny Games-Remake. Aber er ist eben auch auf Ihren Partner Christian Kracht frisiert, der am Drehbuch mitschrieb. Sind solche «phänotypischen Spielereien» im Rückblick ein Fehler, weil sie zu Spiegelgefechten im deutschen Feuilleton führen, die Sie im Grunde gar nicht führen wollen? Oder legen Sie es darauf an.
Ich lese die deutschen Feuilletons nicht, finde das aber sehr lustig, dass Sie Maximilian mit Christian Kracht vergleichen. Ich hatte bei dieser Rolle eigentlich eher an Draco Malfoy aus Harry Potter gedacht. Vor allem war ich für Maximilian auf der Suche nach einem Schauspieler, der rasend gut aussieht. Um zu erklären, dass die Figur der Natalie ihn faszinierend findet, obwohl er ein ziemliches Scheusal ist.
Dieses Scheusal macht die Kälte seiner Kinderstube für seine eigene mitmenschliche Kälte verantwortlich. Auch er sieht sich als ein Opfer: Er könne sich, klagt er, «nicht an eine einzige Umarmung erinnern». In der Debattiernation Deutschland fasst man sich gerne hart an – gerade in Fragen der Moral. Beklagen Sie umgekehrt das Fehlen einer Kultur der Umarmung, der Nestwärme?
Beklagen klingt jetzt falsch, aber es ist wohl das Hauptthema des Films. In Südamerika fand das Publikum es jedenfalls schockierend, dass man sich in Zentraleuropa offensichtlich ein Bärenkostüm anziehen muss, um Umarmungen zu erfahren. In Südamerika umarmt man sich ja ständig und die ganze Zeit.
Letzte Frage – ein verstohlener Blick aus der Schweizer Ecke Richtung Kleiderschrank: Kriegt man Dieter Meier eigentlich immer nur als Dieter Meier ab, oder haben Sie damit geliebäugelt, ihm für seinen Mini-Auftritt wenigstens sein Einstecktuch aus der Tasche zu ziehen?
Dieter Meier und ich waren uns absolut einig, dass ein Pelzhändler einfach ein Einstecktuch tragen muss. Da war es sehr praktisch, dass Dieter Meier das auch privat gerne tut.