Last Days USA 2005 – 96min.
Filmkritik
Die Wahrnehmungswelt des Kurt Cobain

Independent Regisseur Gus van Sant ("Gerry", "Elephant") macht die sprichwörtlichen Drei-aller-guten-Dinge komplett und führt mit "Last Days" erneut vor, wie man elegant auf Handlung verzichten kann und sich stattdessen darauf konzentriert, Wahrnehmungswelten zu schaffen - von Langeweile keine Spur. Im Gegenteil.
Ein junger Mann streunt durch herbstliche Wälder. Es wird Nacht. Er macht ein Feuer. Blake (Michael Pitt - beeindruckend) hat lange, blonde, ungepflegte Haare und erinnert an einen dieser Grunge-Musiker der 90er Jahre - ach ja Kurt Cobain. Von Anfang an hat man den Eindruck, dass dieser Typ, der da wie ein gehetztes Tier durch den Wald irrt und unverständliche Worte vor sich hin brummelt nicht mehr unter den Menschen weilt. Entweder sind da Drogen im Spiel oder Wahnsinn - oder beides.
Zurück in seinem schlossähnlichen Herrenhaus, das er mit vier anderen abwesenden Menschen bewohnt, irrt er weiter wahllos herum, auf der Suche nach etwas, was schon längst den Bach runter geflossen ist. Er findet natürlich nichts, ausser dem Heroin, das er im Garten vergraben hat und dann schliesslich das Nirvana am Ende des Tunnels. Allmählich erfährt man, dass er seinen Drogenentzug abgebrochen hat und sich in seinem Haus verschanzt, Telefonklingeleien ignoriert und das vernünftige Wort des Managements sowieso. Und dann ergeben sich plötzlich diese sachten Andeutungen an die Biografie eben dieses Grungemusikers der 90er Jahre. Aber damit hat sich's auch schon. Mit einer Hommage hat das nichts zu tun. Hin und wieder wird Blakes Universum von Reality-Checks in Form von Eindringlingen durchbrochen: Ein Gelbe-Seite-Verkäufer etwa, junge Mormonen-Missionare oder die Band-Managerin. Diese sorgen zwar für Komik, doch vermögen sie nicht mehr zu bewirken, als kurze Aufhellungen an einem trüben, nebligen Novembertag. Von mehr Bestand sind diejenigen Aufhellungen, in denen Blake zur Musik greift, um der Suppe, die ihn umgibt, Ausdruck zu verleihen. Gerettet hat es ihn nicht.
Gus van Sant ist ungeschlagener Meister in der Disziplin der Erschaffung künstlicher, subjektiv erlebbarer Wahrnehmungswelten. In "Elephant" (2003) und "Gerry" (2002), hat er bereits entwickelt, was er jetzt mit lockerer Hand und Leichtigkeit erneut auf die Leinwand zaubert. Der Trick geht so: Die Kameraführung, die Räume einfängt anstelle von Schauspieler wird unterstützt von eindringlichen, subjektiven Tonwelten: der Atem dicht am Ohr und die Soundeffekte irgendwo drunter oder drüber im auditiven Raum. Das Ergebnis ist erzählte Nicht-Handlung, bestehend aus Alltäglichem und Unspektakulärem. Die Reduktion der Ereignisse schafft also Zeit und Raum für belebte Atmosphäre und subtile Emotionalität. Wer den Einstieg schafft in die Wahrnehmungswelt einer van Sant'schen Figur wird mit einem Kinoerlebnis der unvergesslichen Art belohnt.
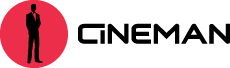















Sie müssen sich zuerst einloggen um Kommentare zu verfassen.
Login & Registrierung