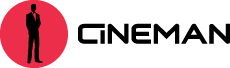Interview
Javier Bardem: «Als Schauspieler hat man immer Angst.»

Der grosse Spanier über die Angst des Schauspielers beim Drehen, das süsse Nichtstun und Julia Roberts.

Javier Bardem
Eat Pray Love basiert auf Liz Gilberts autobiographischem Ratgeber-Bestseller. Ist das ein Buch, das Sie freiwillig lesen würden?
Nie im Leben! (Lacht.) Sagen wir: Vielleicht hätte ich es sogar aus freien Stücken gelesen, aber es fiel mir nie in die Hände. (Lacht wieder.) Das Buch hat mich dann aber schon ziemlich beeindruckt. Da stehen ein paar Dinge drin, die für uns alle von grosser Bedeutung sind. Sich verlieren können, sich selber finden wollen: Es kommt nicht darauf an, ob das eine Frau ist, die es sich leisten kann, nach Indien oder Italien zu gehen. Das Buch dreht sich um die viel allgemeinere Frage: Was ist man im Falle einer Krise zu opfern bereit, um wieder zu sich zu kommen?
Wann kriegt denn ein Javier Bardem die Krise?
Krisen haben wir alle, immer wieder. Und das Gemeine ist, das hört nie auf. (Lacht.) Mit dem Alter werden die Krisen einfach andere. Ich hatte zum Glück noch nie eine derart dramatische existenzielle Midlife Crisis, wie Liz Gilbert sie in ihrem Buch beschreibt.
«Ausbrechen» ist das grosse Thema des Films. Was tun Sie, wenn Sie die Nase voll haben von Ihrem Leben?
Wenn man die wirklich wichtigen Dinge im Leben schätzt, kann man überall Party machen – gleich hier oder im Zimmer nebenan. Ich kann am besten ausspannen, wenn ich die Menschen um mich herum habe, die ich wirklich gerne habe. Wo das ist, spielt keine Rolle. Ich will einfach mit meinen Freunden zusammen sein und meinen Spass haben. Ich will so tun, als ob es nur uns gäbe auf der Welt – und gleichzeitig über uns lachen können.
Ist der Brasilianer, den Sie in «Eat Pray Love» verkörpern, der netteste Kerl, den Sie je gespielt haben?
Sicher weniger kaputt als die andern. (Lacht.) Er ist ziemlich im Reinen mit sich selbst, das mag ich an ihm. Nach Biutiful verspürte ich enorm das Bedürfnis, etwas Helleres machen, ich brauchte etwas Leichteres. Dieser Brasilianer sieht nicht alles so eng wie wie ich als Spanier. (Lacht.) Er hat etwas Weiches, fast scheint er fliegen zu können.
Können Sie heute eigentlich einfach noch irgendwo hingehen?
Ja, klar. Es gibt viele Leute, die keine Filme schauen.
Ein längerer Aufenthalt in Brasilien soll ein Erlebnis gewesen sein, das Sie nachhaltig geprägt hat.
Stimmt. Damals war ich 20, ich hatte die Reise schon lange geplant – gemeinsam mit einem Freund, der mich dann im letzten Moment sitzen liess. Ich stand schon auf dem Flughafen, rief ihn an und fragte: Wo steckst du? Er sagte: Daheim, ich kann nicht mitkommen. Worauf ich entschied, trotzdem zu fliegen – für zwei Monate. Ich hatte schrecklich Angst, allein in einem Land zu sein, dessen Sprache ich nicht beherrschte, über das ich gefährliche Sachen gehört hatte. Aber dann erlebte ich das totale Gegenteil meiner Befürchtungen: Es war wunderschön. Diese Reise war einer der Gründe, warum ich bei «Eat Pray Love» unbedingt dabei sein wollte. Um mal für einen Monat Brasilianer zu sein. (Lacht.) Ich erinnere mich gut an einen Tag am Strand in Brasilien, als mir schlagartig bewusst wurde: Ich bin allein hier, ich kenne niemanden, es könnte mir etwas zustossen, und es wäre einfach allen egal. Das hat mir gezeigt, wie stark wir unsere Mitmenschen brauchen. Sie helfen uns, die zu werden, die wir sind. Mir scheint, ich habe das sehr früh kapiert. Wenn man 20 ist, glaubt man normalerweise, man könne alles allein erreichen, aber das ist nicht der Fall.
Was sind eigentlich die Unterschiede zwischen amerikanischen und europäischen Filmproduktionen?
Das Geld. (Lacht.) Die Länge der Trailer. Die Grösse der Wohnmobile auf dem Set. Und das Catering. Das amerikanische Catering ist der Wahnsinn. (Lacht.) Aber unter dem Strich macht es für mich keinen Unterschied, wo und mit wem ich arbeite. Zwischen den Rufen «Action» und «Cut» fühlt sich für mich alles genau gleich an, da habe ich dieselben Ängste, dieselben Zweifel. Wenn ich in einem Film Englisch sprechen muss, macht mir natürlich die Sprache Angst. Aber man sucht sich ja nur Namen aus für die Ängste, die man hat. Ich kann mich zum Beispiel dafür entscheiden, dass die Sprache mein Problem sei. Wenn ich auf Spanisch drehe, wähle ich eine andere Angst. Dann habe ich zum Beispiel Angst, mich nicht richtig zu bewegen. Als Schauspieler hat man immer Angst, es nicht richtig zu machen – das ist unser Fluch. Meine Mutter, auch eine Schauspielerin, hat mir schon früh gesagt: Mein Sohn, die Angst wird dich dein Leben lang begleiten.
Hat diese Angst auch ihr Gutes?
Ja, sicher. Sie treibt einen an, sie motiviert mich.
Machte Ihnen ein Film wie «Biutiful» mehr Angst als – sagen wir – «Eat Pray Love»?
Ja und nein. Wenn man – wie ich im Falle von «Biutiful» – in jeder Szene eines Filmes zu sehen ist, hat man einfach eine ungeheure Verantwortung. Man trägt ja buchstäblich den ganzen Film auf den Schultern. Dafür kann man als Hauptdarsteller eines Films auch mal eine Szene verbocken und es mit einer anderen wieder gutmachen. Wenn du hingegen eine kleine Rolle hast, wenn du einen ganzen Menschen in fünf Szenen oder fünf Sätzen darstellen sollst, musst du ungeheuer präzise sein. Und wenn man als Nebendarsteller aufs Set kommt, und es hat sich alles schon eingespielt, fühlt man sich oft richtig zugehörig, nicht als Teil der Familie. Das war bei «Eat Pray Love» nicht der Fall; ich fühlte mich bestens eingebunden.
Hatten Sie Angst vor Julia Roberts?
Ehrlich gesagt: nein. Ich komme immer ohne Vorurteile aufs Set, versuche, allen Menschen ohne Vorurteile zu begegnen. Ich hatte Angst, sie würde mich einschüchtern, weil sie eine grossartige Schauspielerin ist. Aber sie war sehr grosszügig, sie ist ausserordentlich nett. Julia bringt die Leute zum Lachen. Sie ist eine sehr lustige Person.
Nach Vicky Cristina Barcelona sagten Sie, Sie seien so erschöpft, dass Sie eine längere Pause bräuchten. Und dann haben Sie «Biutiful» gemacht.
Ich soll gesagt haben, ich sei müde? Glauben Sie nicht, was Sie über mich lesen! Ich habe über mich gelesen, ich würde eine einjährige Auszeit nehmen – und ich arbeite immer noch. Nach jedem Film braucht man eine Pause, weil man sehr viel von sich gibt. Man braucht Pausen, um sich zu erholen, man soll lesen, tief durchatmen, zuschauen, zuhören. Schnitt – und zurück ins Feld.
Javier Bardem macht Pause: Wie muss man sich das vorstellen?
Ich lese viel, besuche Museen, ich schaue mir Gemälde an. Vor «Biutiful» habe ich mir im Prado eine fantastische Francis Bacon-Ausstellung angeschaut. Das war viel wichtiger als alle andern Hausaufgaben, die ich für «Biutiful» zu erledigen hatte. Francis Bacon von ganz nah zu sehen half mir am meisten, meine Rolle zu verstehen. Aber was auch immer ich mache: Ich bin Schauspieler. Ich wiederhole mich.